Die MediaX
Ihre Online Marketing Agentur im ❤️ Salzburgs
Mediax goes Germany
mit Dietmar Nagelmüller
Wir bieten unsere langjährige Expertise im Online Marketing nun auch in Deutschland an!
Mehr erfahren
You’re important – and we know that
Bekannter, Sichtbarer, Erfolgreicher
MArketing Agentur Salzburg & Südostoberbayern
Ihr Erfolg liegt uns am Herzen. Brand Awareness, Leads, Conversions – nichts davon passiert von selbst.
Sie müssen aktiv werden. Präsent sein. Vor allem im Internet.
Denn: Analog allein reicht schon lange nicht mehr.
Digital ist Pflicht!
In der schnellen Welt des Internets genügt es nicht, “dabei zu sein”.
Für den Erfolg braucht es Präsenz auf den passenden Kanälen. Und die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit. Dafür ist einiges an Know-how notwendig. Das Netz ist schnelllebig und erneuert sich ständig.
Dranbleiben ist die Devise. Trends aufgreifen. Auf Veränderungen reagieren.
Sie als Unternehmer sind an vielen Fronten gefordert. Haben Sie auch Zeit, um sich intensiv mit Ihrer Unternehmenspräsenz im Internet zu beschäftigen? Vermutlich nicht.
Deshalb gibt es uns!
Profitieren Sie von Spezialisten und einem Partner, der Sie als Marketing Agentur Salzburg kompetent und ehrlich begleitet.


Warum Wir?
Super digital – super menschlich
Die MediaX ist die Online-Marketing und Social Media Agentur mit Leidenschaft, Expertise, Menschlichkeit.
Unsere Begeisterung ist spürbar.
Wir beherrschen unser Handwerk und sind stets am Puls der Zeit.
In erster Linie aber sind wir Menschen. Engagiert, bodenständig, humorvoll und auf Augenhöhe mit unseren Kunden.
Erbsenzählerei kennen wir nicht. Wir schauen über den Tellerrand hinaus und denken langfristig.
Unser Ziel?
Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner in der digitalen Welt zu sein!
Leistungen
Social Media
Social Media Marketing ist für jedes Unternehmen relevant. Wir unterstützen Sie mit einer fundierten Social Media Strategie, der Auswahl der passenden Social Media Kanäle, Content-Produktion, Community-Management und Reporting.
Mehr erfahren!Webdesign
Erreichen Sie Ihre Kunden über eine ansprechende und funktionale Website. Ob neue Homepage oder Relaunch, One Pager oder Shop – wir beraten und begleiten Sie ab der Planung und designen einen Internetauftritt, der Ihre Kunden überzeugt.
Mehr erfahren!SEO + SEA
Wie werden Kunden auf Ihr Unternehmen aufmerksam? Zuerst muss die Suchmaschine überzeugt werden. Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing bringen Ihre Website auf die vordersten Ränge bei Google & Co.
Mehr erfahren!Content
Texte schreiben sich nicht von selbst. Wir liefern den passenden Content für Website, Blog und Social Media. Damit können Sie Ihre Kunden fesseln. Die Suchmaschinen überzeugen wir zusätzlich.
Mehr erfahren!Videoproduktion + Fotografie
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir liefern Ihnen erstklassige Fotos und drehen Videos, die Aufmerksamkeit erregen. Vom Produktfoto bis zum Imagefilm. Mit Kreativität und Professionalität.
Mehr erfahren!Referenzen
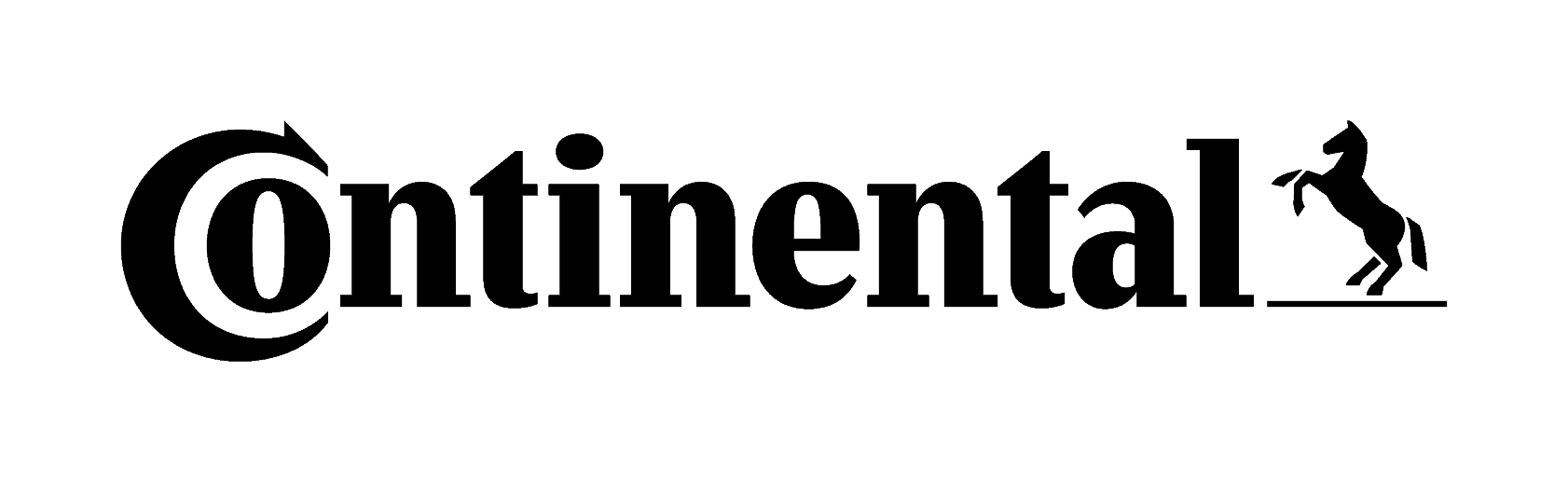




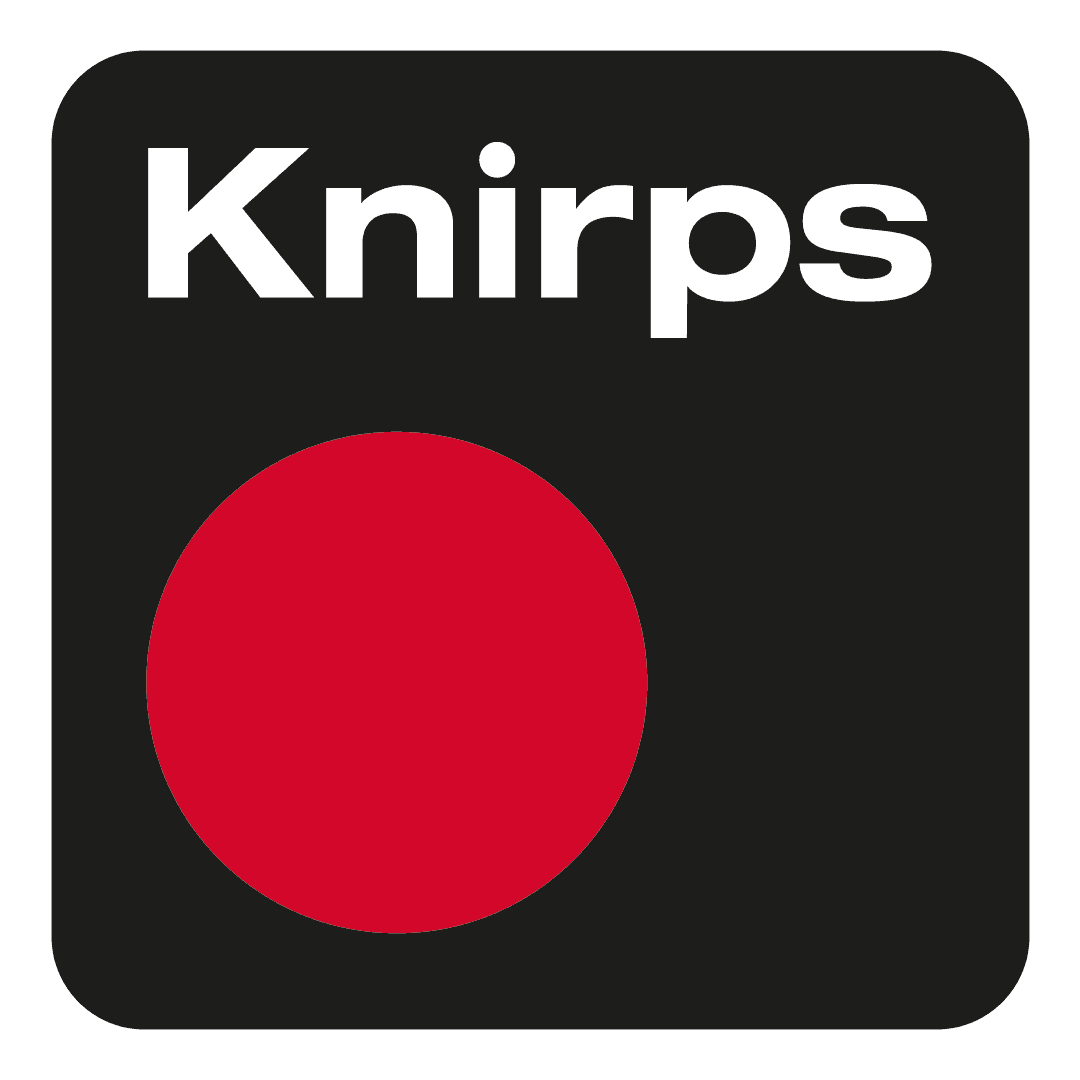







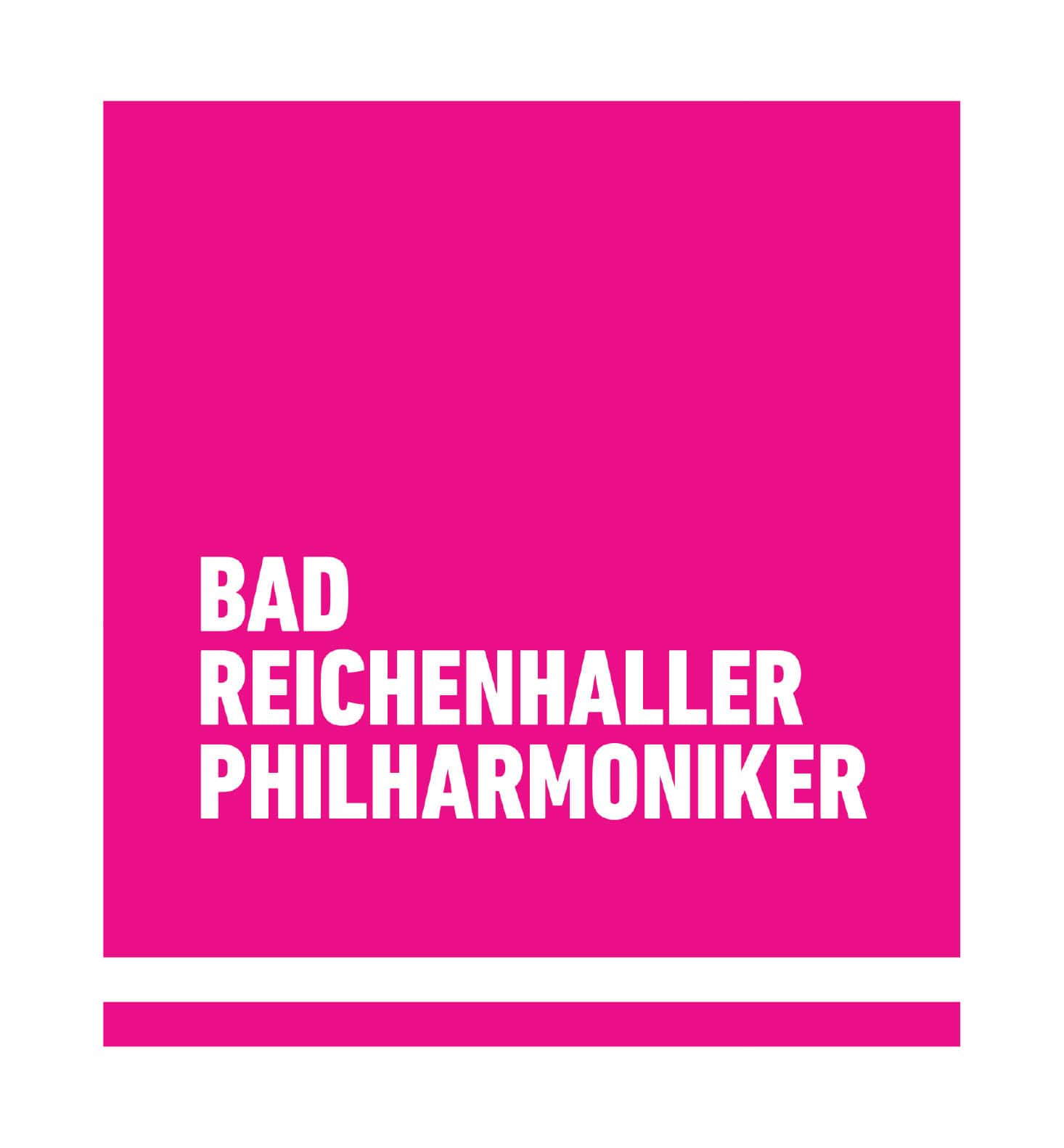

Kundenstimmen

Bei der Zusammenarbeit mit „Die Mediax“ können wir uns jederzeit auf ihren kompetenten und engagierten Einsatz verlassen. Die Vorbereitung und Umsetzung der Fotoshootings ist von professionellem und kreativem Engagement geprägt. Das Ergebnis ist ausgesprochen hochwertiger Content für unseren Social-Media-Auftritt!
TUI BLUE Hotels

Die Mediax betreute zwei Jahre neben meinen Facebook-, Instagram- und Telegram-Account auch mein Google Unternehmensprofil und Newsletter. Ich bin dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen Partner und möchte eine klare Empfehlung aussprechen!
Dr. Spitzbart Seminar GmbH

Die Zusammenarbeit mit dem Team der Mediax in ein paar Worten beschrieben: Sehr professionell, äußerst unkompliziert und immer mit einer Prise Humor. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre!
Continental Reifen Austria GmbH

Wir arbeiten nun seit fünf Jahren eng mit der Mediax zusammen und sind begeistert. Ein kreatives und sympathisches Team mit super Ideen, das sich stets rasch und zuverlässig um unsere Seite kümmert!
OCHSNER Wärmepumpen GmbH

Wir sind sehr zufrieden mit dem kompetenten und sympathischen Team der Mediax. Anfragen werden extrem schnell bearbeitet und es bleibt kein Wunsch offen. Unsere Facebook-Accounts sowie die Website sind immer aktuell.
Macht weiter so!
Schraml – Die Steinwald-Brennerei e.K.

Kreativ, kompetent, flexibel und allzeit verfügbar – das beschreibt die Agentur am besten. Wir arbeiten nun schon seit über einem Jahr mit dem Team der Mediax zusammen und sind mehr als zufrieden. Wir freuen uns auf gemeinsame, spannende Projekte.
Xella Porenbeton Österreich GmbH

Wir haben in „die Mediax“ eine kreative, engagierte Online Agentur gefunden, die unser Unternehmen feinfühlig und mit viel Know-how durch die Social Media Kanäle leitet.
Leidenfrost-pool GmbH

Eine ambitionierte, verlässliche und unkomplizierte Agentur! Es macht Spaß, mit dem Team der MediaX zusammenzuarbeiten. Eine echte Empfehlung meinerseits.
Glas Gasperlmair GmbH

Unsere Pinterest und Facebook Accounts werden von der Mediax betreut. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Kreative Ideen, Fachwissen und Zuverlässigkeit ist das, was die Mediax für uns ausmacht.
Schachreiter Treppenmanufaktur

Das ganze Team ist sehr kompetent und man merkt, dass sie genau wissen, was sie da machen.
Reform Fenster GmbH
Kontakt
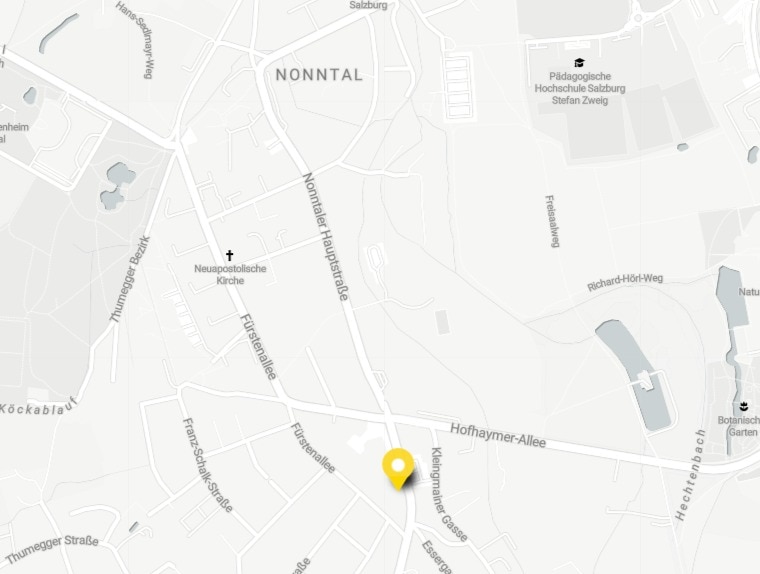
Was ist Social Media Marketing?
Immer mehr Menschen nutzen die sozialen Netzwerke, als Unternehmen dürfen Sie die sozialen Medien keinesfalls unterschätzen.
Beim Social Media Marketing geht es darum, potenzielle Kunden über Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok und Pinterest zu erreichen. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad in den sozialen Medien schrittweise zu erhöhen, Leads zu generieren und ein positives Image zu entwickeln, indem verschiedene Social-Media-Tools und -Plattformen genutzt werden.
Was macht eine Social Media Agentur?
Eine Social Media Agentur kann Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung effektiver Social Media Marketingstrategien unterstützen. Wir bieten Dienstleistungen wie die Auswahl der geeigneten Social Media Plattformen, um die richtigen Zielgruppen anzusprechen sowie die Erstellung hochwertiger Inhalte, die Verwaltung von Communities und die Erstellung regelmäßiger Berichte. Unser erfahrenes Team wird eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu sichern. Darüber hinaus bietet unsere Social Media Agentur professionelles Social Media Management einschließlich Markenaufbau, Optimierung von Konten und Nutzung von Marketing-Tools. Wir bieten eine umfassende Lösung, um Ihre definierten Ziele zu erreichen und ein starkes und konsistentes Branding in allen sozialen Netzwerken aufrechtzuerhalten.
Was kann die MediaX als Digitalagentur für meine Website machen?
Wir helfen Ihnen, eine ansprechende und benutzerfreundliche Website für Ihr Unternehmen zu erstellen. Unser Team ist spezialisiert auf Webdesign und Relaunch, egal ob es sich um eine neue Homepage oder eine bestehende Online-Präsenz handelt. Wir legen Wert auf elegantes Design und einfache Navigation, um Ihren Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Von der Planung bis zur Umsetzung begleiten wir Sie bei der Erstellung eines One-Pagers oder eines professionellen Shops, der Ihre Kunden beeindruckt. Wir unterstützen Sie auch bei der Auswahl und Nutzung von Social Media Kanälen, um Ihre Online-Präsenz zu verbessern. Als Agentur bieten wir einen umfassenden Service, um Ihr Unternehmen im Internet optimal zu präsentieren.
Wer ist die MediaX?
Die MediaX ist eine Werbeagentur in Salzburg mit dem Schwerpunkt auf Social Media Marketing, Content-Marketing, Webdesign, SEO + SEA sowie Videoproduktion und Fotografie. Bekannt wurde die MediaX als Social Media Agentur, unser Portfolio ist jedoch viel größer und wir haben uns als Marketing Agentur Salzburg etabliert.
Das Team der MediaX besteht aus erfahrenen Fachleuten, die Experten in ihren jeweiligen Bereichen sind, einschließlich Marketing, Werbung und Inhaltserstellung. Die MediaX ist bekannt dafür, seinen Kunden hochwertige Lösungen zu liefern, und hat bereits mit zahlreichen bekannten Marken und Organisationen zusammengearbeitet. Wir legen großen Wert darauf, mit den neuesten Trends und Technologien in der Medienbranche auf dem Laufenden zu bleiben, um sicherzustellen, dass sie innovative und effektive Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden anbieten.
Welche Marketingdienstleistungen bietet die MediaX?
Die Media X bietet als Werbeagentur in Salzburg professionelle Dienstleistungen wie Social Media Marketing und Social Media Management, Webdesign, Content-Marketing, SEO + SEA, Videoproduktion, Produktfotos, Imagefilm und mehr.
Welche Vorteile bietet die MediaX?
Die MediaX bietet ihren Kunden mehrere Vorteile. Erstens verfügt die Agentur über ein Team aus Experten auf dem Gebiet der digitalen Medien, Social Media und der Werbung sind. Mit ihrem tiefen Verständnis der Branche können sie wertvolle Erkenntnisse und Strategien liefern, die den Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Zweitens bietet die MediaX eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter digitales Marketing, Social Media Management und kreative Produktion. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es den Kunden, ihre Marketingbemühungen zu rationalisieren und eine kohärente und effektive Kampagne zu gewährleisten. Darüber hinaus setzt die MediaX modernste Technologien und Tools ein, um die Leistung von Kampagnen zu verfolgen und zu analysieren und den Kunden detaillierte Berichte und Daten zur Verfügung zu stellen, die als Grundlage für zukünftige Strategien dienen. Insgesamt bietet die MediaX einen strategischen und ergebnisorientierten Ansatz für Medien und Werbung, der den Kunden hilft, ihre Reichweite zu maximieren und ihre Ziele zu erreichen.
Wie kann die MediaX mein Unternehmen bekannt machen?
MediaX kann Ihr Unternehmen als Media Agentur durch die Schaffung eines starken und überzeugenden Markenimages über verschiedene Medienkanäle bekannt machen. Wir können eine professionelle Website entwerfen und entwickeln, die die Produkte oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens auf attraktive und benutzerfreundliche Weise vorstellt. Als Agentur erstellen wir ansprechende Inhalte für Social-Media-Plattformen, verwalten Online-Werbekampagnen und erstellen Pressemitteilungen, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.
Insgesamt verfügt die MediaX über das Fachwissen und die Ressourcen, um Ihr Unternehmen wirksam zu repräsentieren und es dabei zu unterstützen, sein Zielpublikum zu erreichen.








